Tag: Geschichte

Es war eine ruhige Dämmerung, als die kleine Meerjungfrau Nerina am Ufer des Ozeans saß. Ihre schimmernden Schuppen spiegelten das sanfte Licht des Sonnenuntergangs wider, während die Wellen sanft gegen die Felsen schlugen. Sie wartete auf ihren besten Freund, den großen, freundlichen Wal namens Avan. Jeden Abend kam er vorbei, um mit ihr zu plaudern und die Wunder der Unterwasserwelt zu teilen.
Heute war ein besonderer Abend. Nerina hatte den ganzen Tag aufgeregt das Wasser beobachtet, hoffend, dass Avan bald auftauchen würde. Sie konnte es kaum erwarten, ihm von den funkelnden Korallen und den tanzenden Quallen zu erzählen, die sie entdeckt hatte. Doch die Zeit verstrich, und Avan war noch nicht da.
Ein leises Seufzen entkam ihren Lippen, und sie blickte nachdenklich aufs Wasser. Der Wind flüsterte in den Wellen, als wolle er ihr Mut zusprechen. "Vielleicht ist er einfach nur verspätet", sagte sie sich leise. Nerina zog mit ihren Fingern Kreise ins Wasser und erinnerte sich daran, wie Avan sie immer beruhigt hatte, wenn sie nervös oder traurig war.
Plötzlich spürte sie ein leichtes Vibrieren unter sich, als das Wasser um sie herum zu beben begann. Sie sprang auf, ihr Herz schlug schneller, und da sah sie ihn: Avans riesiger Rücken brach durch die Wellen, und er ließ einen fröhlichen Ruf erklingen. Sein freundlicher Gesang hallte durch die Bucht und ließ Nerina lächeln.

"Endlich bist du da!", rief sie ihm zu, während er näherkam. Avan´s großer Körper glitt elegant durchs Wasser, bis er direkt neben ihr anhielt. "Entschuldige, ich bin spät dran", sagte er mit seiner sanften, tiefen Stimme. "Ich hatte eine besondere Überraschung für dich."
Mit einem Schmunzeln drehte Avan sich um, und hinter ihm tauchte ein Schwarm wunderschöner Fische auf, die in perfekter Harmonie schwammen und ein leuchtendes Muster im Wasser bildeten. Nerina war überwältigt von dem Anblick."Oh, Avan, das ist wunderschön!"
"Ich wollte, dass du etwas Magisches siehst", sagte er sanft. Gemeinsam verbrachten sie den Abend, genossen die Schönheit des Meeres und lachten, während der Ozean in seiner unendlichen Tiefe ihre Freundschaft stärkte.
© Anne Seltmann
Der Name Avan bedeutet so viel wie „das Wasser“
Der Name Nerina, der aus der Tiefe der Meere kommt, ist geheimnisvoll und sanft.
Anne Seltmann 15.10.2024, 10.57 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL

Auf einem kleinen Bauernhof lebten Kühe, Schafe und ein Hahn. Sie hatten alles, was sie brauchten: frisches Gras, leckeres Futter und genug Platz zum Herumlaufen. Aber das Leben war ihnen zu langweilig geworden. Jeden Tag dieselben Routinen: Fressen, Schlafen, Muhen, Blöken oder Krähen. Es fehlte einfach das Abenteuer!
Eines Tages sahen sie aus der Ferne einen Zirkus vorbeiziehen. Bunte Zelte, fröhliche Musik, Kunststücke und Akrobaten. Sie waren begeistert! "Das könnten wir auch!" dachte die kleine Kuh. Die Schafe blökten zustimmend, und der Hahn flatterte aufgeregt umher. Sie beschlossen, Zirkuskunststücke aufzuführen.
Die Kuh wollte auf einem Seil balancieren, die Schafe träumten davon, durch Reifen zu springen, und der Hahn wollte jonglieren. Sie übten heimlich auf der Weide, aber als sie ihren Plan dem Bauern erzählten, lachte er nur. "Ihr seid Nutztiere, keine Zirkusartisten", sagte er kopfschüttelnd.
Doch die Tiere gaben nicht auf. Sie trainierten weiter, jeden Tag ein bisschen mehr. Eines Abends, als der Bauer und die Bäuerin nicht hinsahen, bauten sie heimlich ihre eigene kleine Zirkusvorstellung auf der Wiese auf. Die kleine Kuh balancierte auf einem Holzbrett, während die Schafe durch alte Reifen sprangen. Der Hahn jonglierte geschickt mit Maiskolben und das beste Kunststück kam zum Schluss. Sie bildeten zusammen einen Turm.
Als die Nacht hereinbrach, und der Mond den Hof in ein magisches Licht tauchte, bemerkte der Bauer plötzlich Lachen und Applaus. Verwirrt schaute er aus dem Fenster und traute seinen Augen kaum. Dort, auf der Wiese, leuchtete ihr Zirkus in voller Pracht, und die Tiere zeigten ihre besten Kunststücke.
Der Bauer und die Bäuerin waren beeindruckt. Sie beschlossen, den Tieren ihren eigenen kleinen Zirkus zu überlassen. Von da an fanden jede Woche auf der Weide Zirkusaufführungen statt, und die Tiere waren endlich glücklich, ihre Träume verwirklicht zu haben.
Die Moral der Geschichte? Man sollte nie unterschätzen, wozu jemand fähig ist, wenn er für seine Träume kämpft – auch wenn es nur eine Kühe, Schafe und ein Hahn sind!
© Anne Seltmann
Anne Seltmann 14.10.2024, 09.15 | (1/1) Kommentare (RSS) | TB | PL

Es war einmal ein kleines Mädchen namens Elara, das in einem winzigen Dorf am Rande eines magischen Waldes lebte. Elara war keine gewöhnliche Dorfbewohnerin, sondern eine Zauberin – die jüngste, die das Dorf je gesehen hatte. Schon als Kind konnte sie mit einem Fingerschnippen Blumen zum Blühen bringen, Vögel zum Singen verzaubern und Regenbögen aus den Wolken zaubern. Doch eines Tages beschloss Elara, dass sie nicht mehr zaubern wollte.
Die Dorfbewohner waren erstaunt und verwirrt. "Warum, Elara?" fragten sie. " Deine Magie ist doch so wunderschön und macht uns allen Freude!"
Doch Elara sah nur zu Boden. "Es ist nicht mehr so," sagte sie leise. "Jedes Mal, wenn ich zaubere, fühlt es sich nicht richtig an. Es ist, als ob ein Teil von mir verschwindet, und ich weiß nicht, ob ich es zurückbekomme."
Tief im Wald lebte die weise alte Eule Orla, die alles über Magie und die Geheimnisse der Welt wusste. Elara beschloss, sie zu besuchen, in der Hoffnung, Antworten zu finden. Als sie vor Orla stand, fragte sie: "Warum fühle ich mich so leer, wenn ich zaubere?"
Orla schaute sie mit durchdringenden Augen an. "„Manchmal, kleine Zauberin, wird Magie zu einer Last, wenn sie ohne Grund ausgeübt wird. Du hast deine Kräfte benutzt, um andere zu erfreuen, aber wann hast du das letzte Mal für dich selbst gezaubert?"
Elara dachte nach. Sie erinnerte sich an die vielen Male, als sie zauberte, um die Dorfbewohner zu begeistern – doch nie, um einfach nur zu fühlen, was sie wirklich wollte. Sie hatte vergessen, warum sie überhaupt zauberte. "Aber wie kann ich wieder Freude daran finden?", fragte sie zaghaft.
Orla lächelte. "Du musst herausfinden, was du wirklich willst. Magie ist nichts ohne Herz."
In den folgenden Tagen wanderte Elara durch den Wald, beobachtete die Tiere, die Bäume, den Fluss. Sie ließ ihre Magie ruhen und spürte, wie sich in ihrem Herzen ein neues Verlangen regte – nicht, um zu zaubern, sondern um die Welt ohne Magie zu erleben. Langsam kehrte das Gefühl der Leichtigkeit zurück, und mit ihm das Bedürfnis, die Magie wieder mit Herz zu nutzen.
Eines Morgens, als die Sonne aufging, hob Elara sanft die Hände und ließ einen einzigen Funken Magie los. Es war ein kleiner Zauber, nur für sie selbst – ein winziger Schmetterling, der in allen Farben des Regenbogens schimmerte. Sie lächelte, denn sie wusste: Diesmal war es richtig.
Von diesem Tag an zauberte Elara nur, wenn es ihrem eigenen Herzen entsprach, und ihre Magie war stärker und schöner als je zuvor. Sie hatte gelernt, dass wahre Magie nicht nur aus Zaubersprüchen, sondern aus dem Inneren kommt – aus der Freude, die man in sich trägt.
Und so lebte die kleine Zauberin glücklich weiter, ohne den Druck, ständig zaubern zu müssen. Sie fand ihre Balance zwischen Magie und dem einfachen Leben, und das war die größte Magie von allen.
Anne Seltmann 12.10.2024, 06.18 | (1/1) Kommentare (RSS) | TB | PL

Position: Hafen von Kiel
Heute schreibe ich zum letzten Mal in dieses Logbuch. 40 Jahre auf See – Wellen, Wind, Sturm, Sonnenschein – alles habe ich erlebt.
Doch nun heißt es für mich, Anker werfen und das Steuer ein für alle Mal abgeben.
Die Mannschaft hat heute ein besonderes Frühstück vorbereitet, sogar der Schiffskoch hat seine besten Pfannkuchen gemacht.
Es fühlt sich seltsam an – die vertrauten Geräusche des Schiffes, die knarrenden Planken unter meinen Füßen. Aber dieses Mal führt die Reise nicht in ferne Gewässer, sondern zurück an Land.
Die See hat mich geformt, mir Geduld gelehrt und gezeigt, dass man dem Sturm entgegenblicken kann. Doch jetzt rufen andere Gewässer – ruhigere, sanftere.
Ich werde die Mannschaft vermissen, das Tosen des Meeres und das Gefühl, wenn das Schiff in voller Fahrt über die Wellen gleitet.
Mit einem letzten Blick auf den Horizont, wo der Himmel das Meer küsst, verabschiede ich mich von meinem treuen Begleiter, der mich nie im Stich gelassen hat.
Logbucheintrag geschlossen. Der Kapitän tritt ab.
Anne Seltmann 11.10.2024, 06.45 | (1/1) Kommentare (RSS) | TB | PL

Anne Seltmann 08.10.2024, 15.56 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL

Anne Seltmann 02.10.2024, 09.21 | (1/1) Kommentare (RSS) | TB | PL

Eines sonnigen Tages auf dem Bauernhof beschloss das kleine Schweinchen Piglet, das große Schweinchen Oink um Rat zu fragen. Piglet hatte nämlich etwas sehr Interessantes gehört und war neugierig geworden.
Piglet: "Oink, Oink! Kannst du mir sagen, was ein Web-Blog ist?"
Oink, der gerade gemütlich in der Sonne lag, öffnete ein Auge und schmunzelte. "Ein Web-Blog, sagst du? Nun, das ist eine Art Tagebuch im Internet."
Piglet: "Ein Tagebuch? Im Internet? Aber warum sollte jemand sein Tagebuch ins Internet stellen?""
Oink lachte. "Nun, Piglet, ein Web-Blog ist nicht wie ein geheimes Tagebuch. Es ist eher wie ein öffentliches Notizbuch, in dem Menschen ihre Gedanken, Geschichten und Erlebnisse teilen."
Piglet kratzte sich am Kopf. "Also kann jeder es lesen?"
Oink nickte. "Genau! Und nicht nur lesen, sie können auch Kommentare hinterlassen und mit dem Blogger in Kontakt treten."
Piglet war beeindruckt. "Das klingt ja spannend! Kann ich auch einen Web-Blog haben?"
Oink lächelte. "Natürlich, Piglet! Du könntest über all deine Abenteuer auf dem Bauernhof schreiben. Vielleicht wirst du der berühmteste Blogger unter den Schweinchen!
Piglet hüpfte vor Freude. "Das werde ich tun! Danke, Oink!"
Und so begann Piglet, seine Abenteuer im Web-Blog zu teilen, und wurde bald darauf das bekannteste Schweinchen im ganzen Internet.
© Anne Seltmann
Anne Seltmann 01.10.2024, 14.08 | (3/1) Kommentare (RSS) | TB | PL
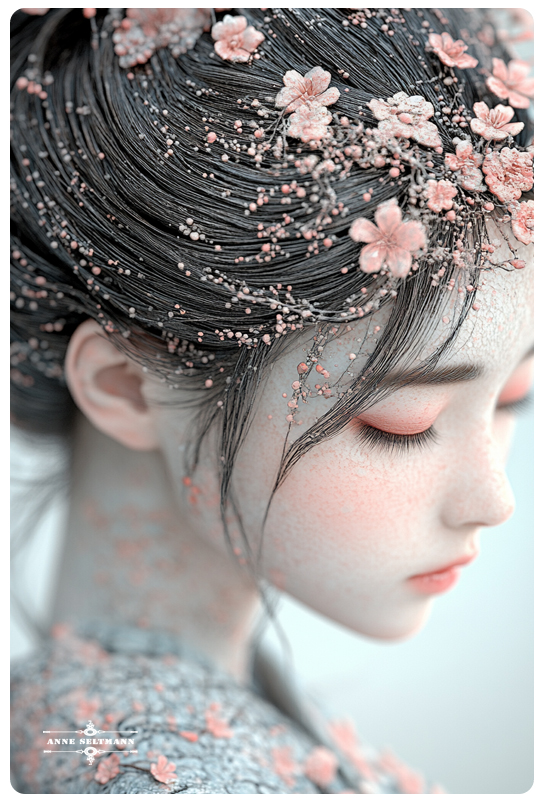


Anne Seltmann 28.09.2024, 16.27 | (4/4) Kommentare (RSS) | TB | PL

Es war einmal ein kleines Schaf namens Leon, das auf einer blühenden Wiese lebte. Jeden Tag sprang er fröhlich zwischen den Blumen umher, doch sein Herz gehörte heimlich dem Schaf Luna, die auf der anderen Seite des Hügels weidete. Leon war schüchtern und traute sich nie, sie anzusprechen, obwohl sein Herz bei jedem Blick auf sie schneller schlug.
Eines Tages, als die Sonne sanft unterging, sah er wie Luna stolperte und in ein Dornengebüsch fiel. Er sah wie verzweifelt sie war, denn ihre Wolle hatte sich in den stacheligen Ästen verfangen und sie wusste nicht, wie sie entkommen sollte. Das war die Chance für Leon. Er fasste sich ein Herz und befreite sie aus ihrer misslichen Lage. Behutsam half er ihr heraus und lächelte sie an.
"Ich habe dich oft beobachtet", sagte Leon schüchtern, "und ich wollte dich schon lange kennenlernen."
Lunas Herz machte einen Sprung. Sie wusste nicht, dass Leon genau dasselbe empfand wie sie. Von diesem Tag an weideten die beiden Schafe Seite an Seite, sprangen über die Wiese und genossen die Sonnenuntergänge gemeinsam. Ihre Liebe blühte, still und sanft, wie die Blumen auf ihrer Wiese.
© Anne Seltmann
Anne Seltmann 27.09.2024, 08.07 | (3/3) Kommentare (RSS) | TB | PL

Sophia saß ruhig auf dem Rücken des sanften Riesen. Die weite, blaue Welt des Himmels umgab sie, während der Wal mühelos durch die Lüfte glitt, als wäre der Ozean unter ihnen verschwunden und das Himmelsmeer sein neues Zuhause geworden. Ihr Kleid flatterte im Wind, und ihre Haare tanzten, als ob sie die Freiheit des Moments spürten.
Seit sie klein war, hatte Sophia davon geträumt, auf einem Wal zu reiten, doch niemals hatte sie sich vorstellen können, dass dieser Traum eines Tages Wirklichkeit werden würde. Es begann, als sie an einem stillen Nachmittag am Strand saß und den Wellen lauschte. Plötzlich tauchte der Wal auf – nicht aus dem Wasser, sondern aus den Wolken. Ohne Worte lud er sie ein, auf seinen breiten Rücken zu steigen, und ohne zu zögern, nahm sie seine Einladung an.
Die Wolken um sie herum sahen aus wie sanfte, flauschige Berge, und der Wind sang eine Melodie, die nur für sie bestimmt schien. "Wohin gehen wir?" fragte Sophia leise, nicht sicher, ob der Wal sie hören konnte. Doch der Wal antwortete nicht mit Worten. Stattdessen spürte sie, wie sein Herzschlag im Einklang mit dem Rhythmus der Welt schlug, und sie wusste, dass es keinen festen Ort gab, den sie erreichen mussten. Der Weg selbst war das Ziel.
Unter ihnen erstreckte sich eine Welt, die für andere unsichtbar war. Goldene Strände und smaragdgrüne Wälder tauchten in der Ferne auf, während leuchtende Fische durch die Wolken schwammen, als wäre der Himmel ein Ozean. Sophia konnte es kaum fassen. Alles um sie herum war so wunderbar, so surreal, und doch fühlte es sich vollkommen richtig an.
Sie fühlte sich sicher auf dem Wal, wie ein Teil von etwas Größerem, etwas Magischem. Der Wal schien das Universum zu kennen, als wäre er ein alter Freund des Himmels und der Erde. In diesem Moment erkannte Sophia, dass sie nie wirklich allein gewesen war. Egal, wohin das Leben sie führte, es gab immer eine Art Magie, die darauf wartete, entdeckt zu werden – man musste nur daran glauben.
Der Wal drehte sanft seinen Kopf, als ob er ihr bestätigen wollte, was sie gerade gedacht hatte. Sophia lächelte und lehnte sich zurück, um den Wind und die Wolken zu genießen. Sie wusste, dass dieses Abenteuer nicht ewig dauern würde, aber das machte nichts. Der Augenblick war perfekt, und das genügte.
© Anne Seltmann
Anne Seltmann 26.09.2024, 11.09 | (3/3) Kommentare (RSS) | TB | PL